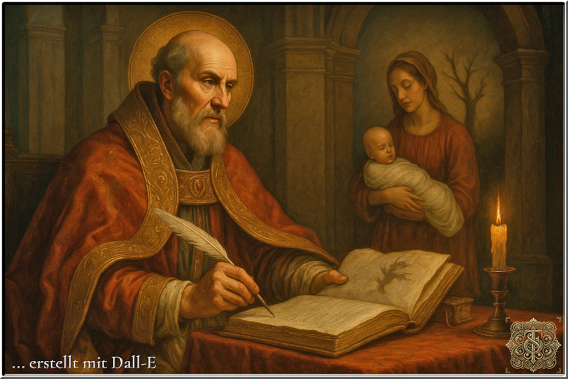Erbsünde und Sünde wider den Heiligen Geist
Zwei Konstrukte christlicher Theologie
1. Einleitung: Von Schuld, Sünde und Macht
Im Zentrum vieler christlicher Glaubenssysteme steht eine doppelte Behauptung: Der Mensch sei von Geburt an sündhaft, und er könne nur durch den Glauben an Jesus Christus und kirchliche Riten (vor allem Taufe und Beichte) von dieser Sünde befreit werden. Zwei zentrale Begriffe, die vom Thema Verstoß und Sühne abweichen, spielen hier eine Schlüsselrolle: Erbsünde und die sogenannte Sünde wider den Heiligen Geist. Beide sind keine ursprünglich biblischen Konzepte, sondern spätere christliche Erfindungen – mit weitreichenden Folgen für Kindheit, Religionszugehörigkeit und Lebensführung.
Die Entstehung dieser Mythen war ein sehr komplexer Vorgang, der sich über mehrere Jahrhunderte vollzog. Ich werde ihn hier in Stichwortform umreißen:
2. Die Erbsünde: Ursprung einer universellen Schuldzuschreibung
2.1 Kein Konzept der Erbsünde im Judentum
In der hebräischen Bibel (Tanach) gibt es keine Vorstellung einer „Erbsünde“. Der Mythos vom „Sündenfall“ in Genesis 3 beschreibt zwar die symbolische Vertreibung aus dem Paradies – aber nicht als eine Vererbung von Schuld. Die jüdische Religion kennt individuelle Verantwortlichkeit (vgl. Hes. 18,20) und betont Umkehr (hebr. Teshuvah) statt kollektiver Verdammnis.
2.2 Paulus und die Geburt einer neuen Idee
Der Apostel Paulus entwickelt in Röm 5,12–19 und 1. Kor 15,21f eine typologische Interpretation: Durch „einen Menschen“ (Adam) sei die Sünde in die Welt gekommen, durch „einen anderen“ (Jesus) die Rettung. Diese theologische Konstruktion ist keine Beschreibung historischer Ereignisse, sondern ein rhetorisch-soteriologisches Konzept: Paulus braucht einen universellen Makel, um Christus als universelle Lösung zu präsentieren.
2.3 Ein moralisch fragwürdiger Gedanke
Die Vorstellung, dass ein angeblich „lieber Gott“ die gesamte Menschheit für den Ungehorsam eines mythologischen Paares bestraft und jedes Kind mit einem Makel auf die Welt kommen lässt, ist aus heutiger ethischer Sicht zutiefst verstörend. Sie verwandelt den Schöpfer in einen rachsüchtigen Despoten.
3. Von David bis Tertullian: Frühformen der Erbsünde
3.1 Psalm 51: Schuld aus der Wiege?
Oft wird Psalm 51,7 zitiert („In Schuld bin ich geboren...“), um Erbsünde zu begründen. Doch handelt es sich hier um poetische Selbstanklage Davids nach seiner Verfehlung mit Batseba – keine Lehre über menschliche Natur.
3.2 Tertullian und der Generatianismus
Erst im 2. Jahrhundert wird der Gedanke „vererblicher“ Schuld erstmals theologisch systematisiert. Der Kirchenlehrer Tertullian behauptet, die Seele werde beim Zeugungsakt über das Ejakulat des Vaters mitvererbt – inklusive der Sündhaftigkeit (Generatianismus). Daraus folgt: Jedes Kind muss getauft werden, um von dieser Schuld „gereinigt“ zu werden.
3.3 Laktanz und der Kreationismus
Dem widerspricht Lactantius, der im 3. Jahrhundert lehrt, dass jede Seele neu von Gott geschaffen wird (Kreationismus). Moderne Kirchen lehren heute meist diese Sicht – was die Erbsünde logisch ad absurdum führt.
4. Augustinus und der Sieg der Schuldlogik
4.1 Augustinus' Sündenanthropologie
Augustinus von Hippo (4./5. Jh.) entwickelt die Lehre der Erbsünde systematisch weiter. Dabei verbindet er Tertullians Generatianismus mit paulinischer Soteriologie. Jedes Neugeborene sei bereits schuldhaft – nur die Taufe könne es retten. Dieses Dogma legitimiert die Kindertaufe und schafft damit die Grundlage für die Zwangsvermitgliedschaftung von Säuglingen in die Kirche.
4.2 Pelagius – Ein vergessenes Gegenmodell
Sein Zeitgenosse Pelagius vertritt eine deutlich humanere Sicht: Der Mensch werde ohne Schuld geboren und sei selbst verantwortlich für sein Handeln. Er glaube an Willensfreiheit und persönliche Umkehr. Für Augustinus war das Häresie: Der Mensch sei schwach und auf Gnade angewiesen – regelmäßig, dauerhaft, kirchlich vermittelt.
4.3 Erbsünde als Instrument kirchlicher Kontrolle
Mit der Erbsündenlehre entsteht ein genialer theologischer Hebel: Jeder Mensch braucht die Kirche, braucht Sakramente, braucht Priester. Und wer sich dieser Notwendigkeit entzieht, gefährdet angeblich sein Seelenheil. Die Kirche wird zum alternativlosen Heilsmonopol.
5. Kritische Stimmen aus der Moderne
- Hans Küng kritisierte die Erbsündenlehre als „unerträgliche Hypothek für die Gottesvorstellung“. Sie sei „mit einem gerechten und barmherzigen Gott unvereinbar“.
- Dorothee Sölle sah in der traditionellen Sündenlehre eine „männliche Herrschaftsideologie“, die das Selbstwertgefühl und die Eigenverantwortung untergräbt.
- Eugen Drewermann verweist auf die psychologische Dimension: Die Erbsündenlehre erzeugt „lebenslange Schuldgefühle“ – oft bereits im Kindesalter.
- Gerd Lüdemann bezeichnete die Erbsündenlehre als eine „perverse Erfindung zur Institutionalisierung religiöser Abhängigkeit“
6. Die Sünde wider den Heiligen Geist: Eine nicht vergebbare Schuld?
6.1 Die biblischen Belege
Die Synoptiker zitieren Jesus mit folgender Warnung:
„Wer aber gegen den Heiligen Geist sündigt, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben.“
(Mk 3,29; Mt 12,31f; Lk 12,10)
Auch im Hebräerbrief (10,26–29) und im 1. Johannesbrief (5,16f) ist von „unvergebbarer Sünde“ die Rede.
6.2 Der Hintergrund: Apologetik und Abgrenzung
Die „Sünde wider den Geist“ zielt ursprünglich nicht auf Unglauben, sondern auf das vorsätzliche Lächerlichmachen spiritueller Erfahrungen (z. B. das Zuschreiben göttlicher Wunder an den Teufel). Später wird der Begriff ausgeweitet, um Abtrünnige, Ketzer oder Kritiker zu stigmatisieren.
6.3 Theologisch höchst problematisch
Die Idee einer nicht vergebbaren Sünde widerspricht sowohl Jesu eigener Botschaft von Umkehr als auch dem Prinzip der göttlichen Barmherzigkeit. Wenn Gott allmächtig und vergebungsbereit ist – warum sollte eine einzelne Handlung unwiderruflich sein?
6.4 Trinitätstheologie als nachträgliche Lesart
Jesus kannte keine Trinitätslehre. Der Begriff „Heiliger Geist“ wurde erst später dogmatisch aufgeladen. Die Vorstellung, man könne „gegen den Heiligen Geist“ sündigen, ist spätere theologische Interpretation, die vor allem in innerkirchlichen Machtkonflikten zur Anwendung kam.
Fazit: Vom Dogma zur Desinformation
Die Lehre von der Erbsünde und die Vorstellung der Sünde wider den Heiligen Geist sind keine ewigen Wahrheiten, sondern menschengemachte Konzepte, um religiöse Kontrolle auszuüben. Sie widersprechen den Grundprinzipien moderner Ethik, Psychologie und Humanität.
Wer heute Kindern einredet, sie seien von Geburt an schlecht und müssten durch Rituale „gereinigt“ werden, betreibt keine Seelsorge – sondern seelische Manipulation. Und wer diesen Kindern später erzählt, manche Zweifel könnten „nicht vergeben werden“, instrumentalisiert Religion für Angst und Abhängigkeit.
Was junge Menschen wissen sollten:
- Du kommst nicht mit Schuld zur Welt. Deine Würde und dein Wert sind nicht von religiösen Riten abhängig.
- Kritisches Denken, Zweifel und eigenverantwortliche Entscheidungen sind keine Sünde, sondern Zeichen von Reife.
- Wenn Gott Liebe wäre, müsste er Menschen nicht mit Angst erziehen.
- Die Lehre von der Erbsünde ist ein kulturelles Artefakt – kein Naturgesetz. Und wer dich mit der Sünde wider den Heiligen Geist einschüchtern will, will nicht dein Bestes.
Funfact am Rande:
Wer wissen will, wieso die Erbsünde jedwede moderne Hermaneutik ad absurdum führt und eine wörtliche Bibelinterpretation fordert, wird hier fündig: