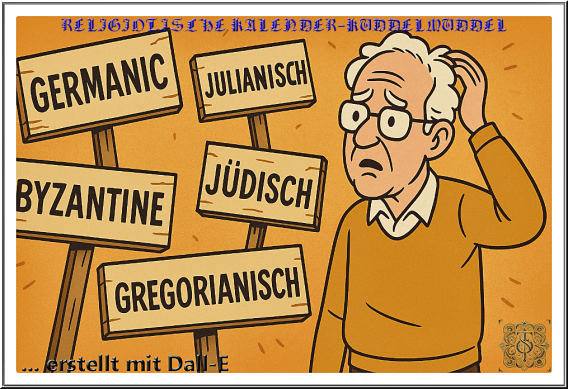Welcher ist der 7. Tag?
Freitag? – Samstag? – Sonntag?
„Kalendersysteme sind wie Religionen: Jeder schwört auf seins, keiner kann beweisen, dass es stimmt – und am Ende kommt doch Montag.“
Das ist wieder einmal so ein Thema bei dem ich mich fast selbst verlaufen hätte. Eigentlich sollte das ein Plädoyer für einen rein astromischen Kalender werden. Aber dann?
Doch seht selbst:
Ein Blick auf „unseren“ nordisch-germanischen Kalender:
Unsere Vorfahren, die Germanen und Nordvölker haben sich noch in etwa an diesem astronomischen Jahreskreis orientiert. Ursprünglichen hatten sie keinen fest standardisierten 7-Tage-Rhythmus, sondern orientierten sich an:
- Mondphasen
- Jahreszeiten
- wichtigen Festtagen oder landwirtschaftlichen Tätigkeiten: Erstes Grün, Erntebeginn, Schlachtzeit
Erst durch Kontakt mit Rom (ca. 1.–4. Jahrhundert n. Chr.) verbreitete sich die 7-Tage-Woche – die Germanen ersetzten jedoch die römischen Götternamen durch ihre eigenen „Thor, Freya, Wodan & Co“, die im modernen Kalender noch mit zwei linguistischen Fossilien durchschimmern:
Donnerstag + Freitag (engl.: Thursday + Friday) = Thors/Donars Tag + Tag der Frigga/Freya
Bei den nordischen Völkern begann jeder Monat mit dem Neumond. Darüber hinaus kannten die Germanen zwei Hauptjahreszeiten (Lidhas):
- Sommer (samo) – hell, warm, Zeit des Kampfes und Reisens
- Winter (wintar) – dunkel, kalt, Zeit des Hauses und der Erzähltraditionen
Das Jahr begann mit dem Winteranfang um den Julmond (Wintersonnenwende) und hatte normalerweise 12 Monate. Da jedoch der Mondzyklus vom Jahreskreis der Sonne abweicht, war es alle paar Jahre nötig, einen Schaltmonat, das dritte Lidha, einzufügen, um die Zyklen zu synchronisieren.
Die „normalen Monate“
| Monatsname |
Herleitung |
röm. Entsprechung |
| Julmond | Monat des Julfestes | Dezember |
| Hartung | harte, kalte Zeit | Januar |
| Hornung | mglw. „Geweih(Horn)-Abwurfzeit“ | Februar |
| Lenzing | Lenzmond Frühlingsmond | März |
| Ostermond | Monat des Ostarafestes | April |
| Winnemond | Weidemonat, Beginn der Weidezeit | Mai |
| Brachet | Monat des Umbrechens (‚brachen/pflügen‘) | Juni |
| Heuert | Monat der Heuernte | Juli |
| Ernting | Erntemonat | August |
| Scheiding | Monat der Viehscheide / Ende der Weidezeit | September |
| Gilbhard | Monat der Gelbfärbung des Laubs | Oktober |
| Nebelung | Nebelmond | November |
Der moderne Kalender wurde den Nordvölkern oktroyiert
Wobei in multikulturellen Ländern wie Deutschland, auffällt, dass man sich über die Einteilung herzlich uneinig ist. Werfen wir einen Blick auf die abrahamitischen Hoch-Tage der Woche, die normalerweise den Wochenlauf beenden. Im Islam ist das der Freitag, der Sabbat (Samstag) gilt im Judentum und der Sonntag im Christentum. Alle drei Einteilungen orientieren sich allerdings an einer 7-Tage-Woche, die zu einer Zeit eingeführt wurde, in der moderne Kalender noch gar nicht existierten.
Tatsächlich wurde die 7-Tage-Woche bereits lange vor naturwissenschaftlichen Kalendern erfunden, – von Menschen, die die Welt mit religiösen Vorstellungen erklärt haben – und das, obwohl ihnen lediglich astronomische Beobachtungen zur Verfügung standen.
Wie kam man aber auf 7 Tage, obwohl der Mondzyklus gar nicht dazu passt?
- In Babylon (vor über 2500 Jahren) verehrte man 7 Himmelskörper, die man mit bloßem Auge sehen konnte:
Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn.
→ Jeder Tag wurde einem dieser Himmelskörper „geweiht“. - Die Juden übernahmen diese 7-Tage-Einteilung und gaben ihr eine religiöse Bedeutung:
Gott erschafft die Welt in sechs Tagen – und ruht am siebten. – (Allerdings weicht der jüdische Jahreskalender, der bereits einen in Monate eingeteilten Jahreskreis kannte deutlich vom byzantinisch-römischen Kalender ab, wie wir im nächsten Abschnitt zeigen werden) - Diese Erzählung wurde später von Christentum und Islam übernommen.
→ Sabbat = Samstag für Juden, Sonntag für Christen, Freitag für Muslime.
Die 7-Tage-Woche ist keine astronomische Erfindung – sie ist ein religiös-kulturelles Konstrukt.
Dass sie nichts mit der realen Mondbewegung zu tun hat, störte damals niemanden, weil es keine präzise Astronomie gab – und weil Religion bestimmte, was „richtig“ ist.
Auch heute noch eine Besonderheit: Der jüdische Kalender
Die jüdische Zeitrechnung beginnt nach christlicher Zeitrechnung im Jahr 3761 v. Chr., dem traditionellen biblischen Jahr der Schöpfung der Welt.
Der jüdische Kalender wird durch die Einteilung in ein Lunisolarjahr gegliedert. Das bedeutet, die Monate basieren auf dem Mondzyklus (29 oder 30 Tage), während durch regelmäßige Schaltjahre die Abweichung zum Sonnenjahr ausgeglichen wird, um die jahreszeitlichen Feste im richtigen Zeitraum zu halten.
Das jüdische Jahr beginnt im Herbst mit dem Monat Tischri und wird in 12 (oder in Schaltjahren 13) Monate unterteilt:
Tischri, Cheschwan, Kislew, Tewet, Schwat, Adar, Nissan, Ijar, Siwan, Tammus, Aw, Elul + 13. Monat, Adar II, der alle 19 Jahre als Schaltmonat hinzugefügt wird.
Die Woche hat sieben Tage und beginnt am Sonntag. Der siebte Tag ist der Sabbat (entsprich dem Samstag).
Ein jüdischer Tag beginnt bei Sonnenuntergang und wird in 24 „Sha'ot“ (Stunden) eingeteilt, die allerdings nicht immer gleich lang sind, und jede Stunde wird wiederum in 1080 „Chalakim“ (Singular: Chelek) unterteilt.
Ein Chelek ist exakt 1/1080 einer Stunde, also 3 + 1/3 Sekunden (d.h. 18 Chalakim entsprechen einer modernen Minute). Dieses System ermöglicht extrem genaue Berechnungen, die für die Konsistenz des jüdischen Kalenders über Jahrtausende hinweg entscheidend sind.
Als wäre das noch nicht verwirrend genug: Warum gibt es zwei christliche Kalender?
Das Christentum benutzt im Kern zwei verschiedene Kalender
- Den julianischen Kalender (älter – heute noch bei orthodoxen Ostkirchen)
- Den gregorianischen Kalender (jünger – heute weltweit Standard)
Beide Systeme versuchen, den Lauf der Sonne möglichst genau abzubilden, damit kirchliche Feiertage (insbesondere Ostern) nicht „verrutschen“.
Ursprünglich galt der Julianische Kalender, der 45 v. Chr. von Julius Caesar eingeführt wurde:
- Fixe Länge: 365 Tage
- Alle 4 Jahre ein Schaltjahr mit 366 Tagen
- Jahresmittel: 365,25 Tage
Der brachte allerdings ein Problem mit: Da das Sonnenjahr 365,24219 Tage dauert, ist der julianische Kalender um 11 Minuten zu lang.
Das klingt wenig, aber:
- In 128 Jahren verschiebt sich das Jahr um 1 Tag.
- Nach 1000 Jahren lag der Kalender 7–8 Tage „daneben“.
- Folge: Frühlingsanfang (wichtig für Osterberechnung) wanderte immer weiter weg.
Die Osterformel – der wahre Streitpunkt
Das Konzil von Nicäa (325) legte fest:
Ostern soll am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond stattfinden. Wenn aber der Kalender driftet, dann fällt der „kalendermäßige Frühlingsanfang“ nicht mehr mit dem astronomischen zusammen. Und in der Folge wandern alle beweglichen christlichen Feiertage (Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, etc.) Und genau DAS wurde im Mittelalter zum Problem. Die Lösung:
Der Gregorianische Kalender
Er wurde 1582 von Papst Gregor XIII. eingeführt, dessen erste „Reparaturmaßnahme“ darin bestand dass er am Donnerstag, 4. Oktober
10 Tage übersprang und mit Freitag, 15. Oktober fortfuhr.
Und er führte eine neue Schaltjahrregel ein:
Alle vier Jahre ist ein Schaltjahr mit einem zusätzlichen Tag (dem 29.) im Februar. Fällt das Schaltjahr jedoch auf einen vollen 100er-Abschnitt, wird der 29. Februar ausschließlich in den Jahren eingeschoben, die durch 400 teilbar sind. Das heißt zum Beispiel:
1600 war ein Schaltjahr – 1700 bis 1900 waren KEINE Schaltjahre, aber das Jahr 2000 war wieder ein Schaltjahr.
Das Ergebnis: Die Jahreslänge beträgt 365,2425 Tage und es gibt lediglich noch 1 Tag Abweichung in 3300 Jahren statt wie im julianischen Kalender alle 128 Jahre.
Warum machen die Ostkirchen nicht mit?
Weil Kalender nicht nur etwas mit Astronomie zu tun hat, sondern auch mit Identität und Macht.
Die orthodoxen Argumente:
- „Wir halten an der Tradition fest.“
- „Der Westen (Rom) hat ohne uns reformiert.“
- „Es geht nicht nur um Astronomie und Mathematik, sondern um heilige Zeit.“
Einige orthodoxe Kirchen haben zwar einen „revidierten julianischen Kalender“, nutzen aber für Ostern immer noch die alte Berechnung.
Dadurch liegt das orthodoxe Ostern oft 1–5 Wochen später als das westliche.
Eine Einigung ist auf lange Sicht nicht absehbar, obwohl aus wissenschaftlicher Sicht der gregorianische Kalender objektiv genauer ist.
Psychologisch-kulturelle Belange wiegen wohl einfach schwerer. Der julianische Kalender ist nun einmal Teil der orthodoxen Identität, und viele Gläubige empfinden eine Umstellung als „Unterwerfung unter Rom“, und kein Patriarch möchte derjenige sein, der nachgibt.
Beide Kalendersysteme haben Schwächen, ...
..., aber warum hat man im Westen am gregorianischen Kalender festhalten?
Weil seine Einteilung über 440 Jahre lang eingeübt wurde – und alles darauf basiert:
- Arbeitsrhythmus (5 Tage Arbeit, 2 Tage Wochenende)
- Feiertage
- staatliche Gesetze
- Schulen
- internationale Verträge
Ein riesiges soziales System basiert auf: „Alle 7 Tage kommt ein neuer Wochenanfang.“ - So etwas ändert man nicht einfach – selbst dann nicht, wenn es wissenschaftlich gesehen Unsinn ist.
Wäre ein weltweit gültiger „Sternzeitkalender“ die bessere Lösung?
Damit ist ein Kalender gemeint, der frei von religiösen Bezügen ist und sich an den astronomischen Fakten orientiert:
Ein Mondzyklus (= Monat) dauert durchschnittlich etwa 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten – also 708 Stunden und 44 Minuten, bzw. 708,733 Stunden… Jede der vier Mondphasen (= Woche) dauert demnach 177,183 Stunden
Ein wahrer Sonnentag im Laufe des Jahres dauert zwischen etwa 24 Stunden -21,3 Sekunden und 24 Stunden +13,1 Sekunden; im Mittel 23:56‘4“ also 23,933 Std.
Das bedeutet, dass eine Mondphase (Woche) 177,183 : 23,933 = 7,4033 Tage dauert.
Was spricht FÜR ein solches System?
- Wissenschaftlich sauberer:
Mondphasen könnten echte Wochen bilden – z. B. 4 Mondphasen pro Monat. - Naturnäher:
Man würde direkt am Himmel ablesen können, in welcher „Woche“ man ist. - Keine religiöse Sonderbehandlung:
Keine Religion könnte sagen: „Mein Tag ist wichtiger als deiner.“ - Spannend für Bildung:
Schüler:innen würden automatisch mehr über Astronomie lernen.
Die Argumente DAGEGEN wiegen jedoch schwerer:
- Chaos im Alltag:
Unsere gesamte Welt basiert auf 7-Tage-Zyklen. Das umzustellen wäre ein globales Organisationsdrama. - Unpraktisch:
Eine Mondphase dauert 8,16 Tage – das gibt keine sauberen Wochen.
→ Ein „Monat“ hätte mal 29, mal 30 Tage. - Religionen würde protestieren:
Viele Glaubensgemeinschaften würden sich massiv wehren, wenn man ihre heiligen Wochentage „abschafft“. - Technische Probleme:
Computer, Kalender-Apps, internationale Absprachen – alles müsste umprogrammiert werden.
Fazit in einem Satz:
Die 7-Tage-Woche ist kein Naturgesetz, sondern ein religiöses Erbe –
aber so tief im Alltag verankert, dass wir sie behalten,
obwohl sie astronomisch falsch ist.